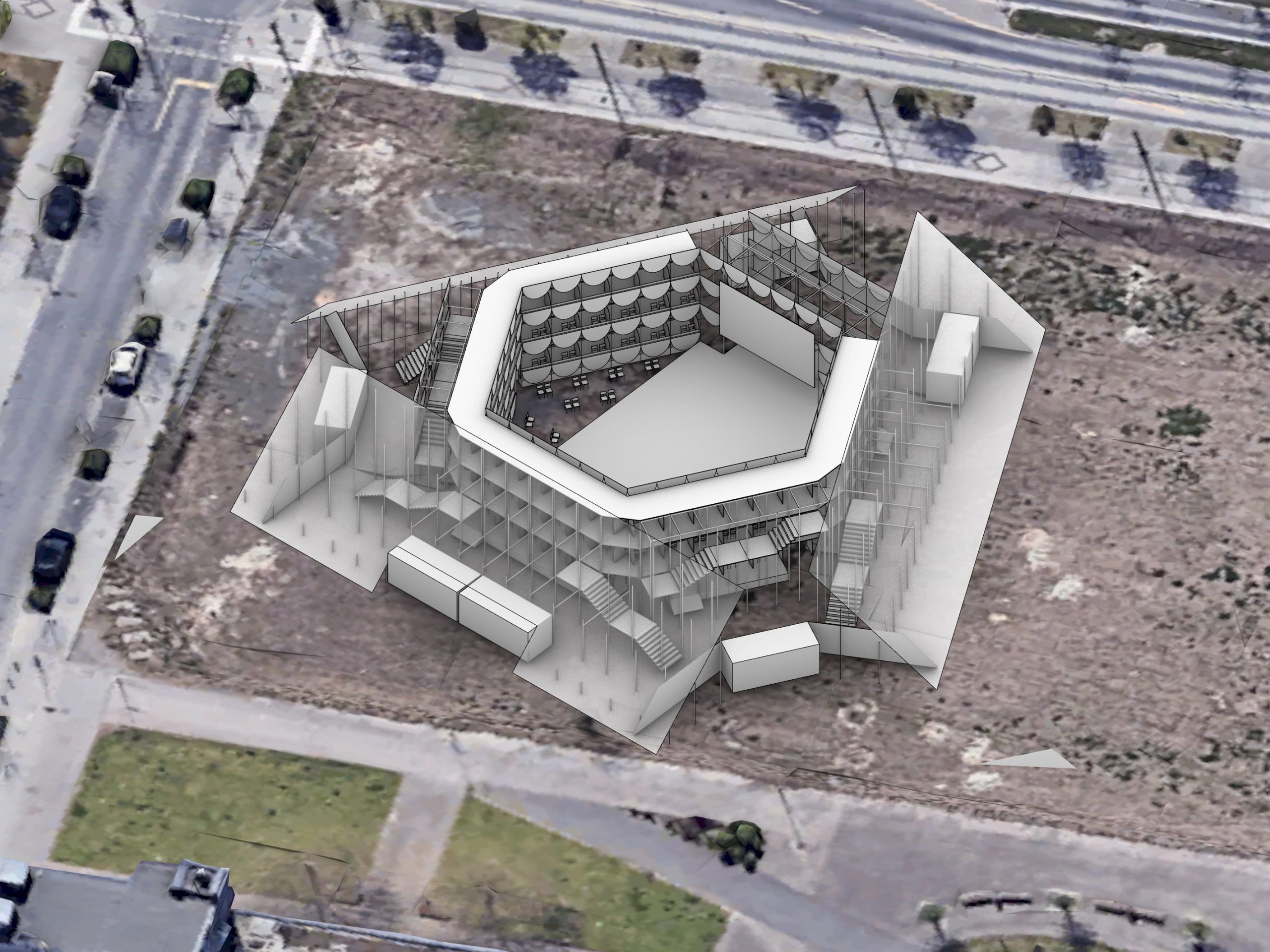Genmix
Ich habe mich stundenlang gefragt, warum sich diese beiden Dinge seit Stunden in meinem Kopf verbinden: die kleine S. und dieses großartige Interview über Rassen und Rassismus. Ich glaube, jetzt weiß ich es.
Gestern ist die kleine S. drei Jahre alt geworden. Ich habe sie ein paar Tage davor bei einem Arbeitstreffen kennengelernt, zu dem ihr Vater sie mitgebracht hatte. Er ist Sozialwissenschaftler und gehört zu den Leuten, denen zum Beispiel das Gendern beim Reden schon in Fleisch und Blut übergegangen ist. Da wird vor dem Binnen-I ein Sprechpäuschen eingelegt (Teilnehmer-innen etc.), und das mit einer Selbstverständlichkeit, die in scharfem Kontrast zu manchen Debatten in meinem Freundeskreis steht. Das sind keine verbohrten Konservativen, meine Freund-innen, aber sie tun sich extrem schwer mit der Anforderung einer (noch) Minderheit, ihre Sprechweisen zu ändern. Das finde doch ohnehin nur in irgendwelchen »Blasen« statt, hat mir gerade wieder einer meiner Liebsten entgegengehalten.
Ich habe mir vorgestellt, dass solche Dinge wie das Gendern für die kleine S. vollkommen normal sein werden, wenn sie erwachsen wird. Ich ecke zwar regelmäßig schmerzhaft an, wenn ich das im Freundeskreis sage, aber ich glaube, es wird passieren und die Sprache wird es überleben, wie sie auch andere Veränderungen schon überlebt hat.
Wir kennen diese Debatten ja nicht nur vom Gendern, siehe nur das »N-Wort«. Ich finde schon, dass das antirassistische Engagement manchmal zu irritierenden Ausschlägen führt – zum Beispiel, wenn infrage gestellt wird, ob weiße Menschen das Gedicht einer Schwarzen Autorin übersetzen können. Aber ich lehne dieses Engagement deshalb nicht pauschal ab wie andere, die sich darüber erstaunlich heftig aufregen können.
Nehmen wir mal das Wort »Rasse«, das ja bekanntlich im Grundgesetz steht (Niemand darf wegen…benachteiligt werden). Das waren ja keine Rassistinnen und Rassisten, die das 1949 aufgeschrieben haben, das Wort »Rasse« war damals das Selbstverständlichste der Welt. Aber jetzt kommt das Interview: Johannes Krause ist »Archäogenetiker« ein Wort, das ich bis gestern nicht kannte. Er erforscht das Genmaterial in Knochenfunden und erzählt in dem Interview zum Beispiel, dass der Ackerbau von Anatolien nach Mitteleuropa kam, kurz gesagt: Das schöne christliche Abendland verdankt sich wahrscheinlich »Türken« – und wir sind keine »Rasse«, sondern ein lustiger Genmix aus allem Möglichen.
In meinem Freundeskreis gibt es nun wirklich keine Rassistinnen und Rassisten. Aber ich bin einfach froh, den Zweifelnden dort etwas entgegenhalten zu können: dass das Denken und die Sprache sich entwickeln, je nachdem, wo das Licht der Aufklärung gerade leuchtet. Also werde ich ihnen auch beim nächsten Mal erzählen, dass das Lernen beim Umgang mit Wörtern ein schöner Fortschritt sein kann, egal ob es um Geschlechter geht oder um »Rassen«.